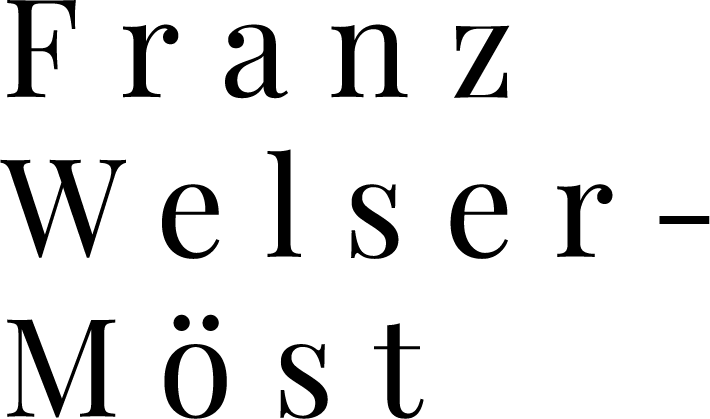Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten: Paul Hindemith, Richard Strauss, Arnold Schönberg und Maurice Ravel

Beim 5. Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker (24. und 25. Februar 2024) unter Franz Welser-Möst standen auf dem Programm:
Paul Hindemith, Konzertmusik für Blasorchester, op. 41
Richard Strauss, Sinfonische Fantasie aus Die Frau ohne Schatten, o. Op., AV 146
Arnold Schönberg, Variationen für Orchester, op.31
Maurice Ravel, La Valse. Poème chorégraphique pour Orchestre

Franz Welser-Möst zu den Werken (aus dem Programmheft zum 5. Abonnementkonzert 2023/2024):
Paul Hindemith steht selten auf den Konzertprogrammen, obwohl er in der Zeit der Weimarer Republik ein für Experimentelles geschätzter und viel aufgeführter Komponist war. Hindemith wird oft als trocken-akademisch angesehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat bewusst versucht, das Akademische auf die Seite zu schieben, hatte durchaus Humor. Um neue Ausdrucksformen zu finden, experimentierte er mit überkommenen Formen. Er hat Gebrauchsmusik komponiert und sich dabei nicht zuletzt an den ausführenden Musikern orientiert. Für Studierende hat er einfache Stücke geschrieben. Nicht nur die Machbarkeit, sondern auch die Einfachheit an sich waren ihm ein wichtiges Anliegen: So viele Menschen wie möglich sollten zur klassischen Musik Zugang finden. Eine Strömung dieser Art gab es auch im von den Sozialdemokraten von 1919 bis 1934 regierten „Roten Wien“, wo in Gemeindebauten sogenannte „Arbeiterkonzerte“ stattfanden. Klassische Musik sollte nicht nur für Reiche verfügbar sein, sondern auch für Arbeiter. Die Konzertmusik für Blasorchester ist keine Militärmusik, obwohl sie für eine Militärkapelle entstand. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil – Konzertante Ouvertüre – bricht mit der Erwartungshaltung an Militärmusik. Hindemith greift auf die Tradition der im 18. Jahrhundert und in der frühromantischen Zeit häufig aufgeführten Ouvertüren zurück. In diesem Teil hört man Anklänge an die italienische Operntradition à la Rossini und an die deutsche Operntradition à la Weber. Das beweist Humor, ist einfache, aber nicht simple Musik. Der zweite Teil besteht aus sechs spielerischen Variationen über das österreichische Volkslied Prinz Eugen, der edle Ritter. Da ist wieder ein Bezug auf Wien gegeben, wo das Lied beinahe jeder mitpfeifen kann. Prinz Eugen (1663–1736) aus dem Haus Savoyen war einer der bedeutendsten Feldherren der Habsburgermonarchie und ein großer Förderer der Künste. Der dritte Teil ist ein Marsch, hier wieder als Ausdruck einfacher Musik zu verstehen.

Richard Strauss war ein Meister der Orchestrierung. Für diese Sinfonische Fantasie hat er einige Passagen aus der Oper Die Frau ohne Schatten herausgenommen und zu einer großen sinfonischen Dichtung zusammengefügt. Richard Strauss komponierte mit dieser Oper „seine Zauberflöte“ während der Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Frau ohne Schatten vermittelt hingegen in ihrer Rauschhaftigkeit eine Gegenwelt: ein Märchen mit viel Spielraum für Unlogisches und Irreales, aber auch für die Fantasie. Die Gedanken, die der Oper zugrunde liegen, sind auch in der Sinfonischen Fantasie aus der Oper enthalten, die mit dem Keikobad-Motiv aus dem Geisterreich beginnt und somit gleich in die Märchenwelt führt. Es ist typisch für Richard Strauss, dass er zum Schwelgerischen verführt. Das geistige Gerüst jedoch ist sehr klassisch, beruhend auf der Antike und der Aufklärung, Mozart war sein absoluter Gott: Seine Ideale sollten über die 1920er Jahre mit all ihren Umbrüchen hinübergerettet werden. Die Diszipliniertheit im Formalen wie im Denken war Strauss sehr wichtig. Das prägt meine Herangehensweise: Nicht dem nachzugeben, wo es verführerisch wäre, zum Beispiel, ein Rubato einzubauen. Ich möchte eine sehr klare Ausdruckssprache finden, die gleichzeitig jedoch von den Klangfarben her etwas Dionysisches hat.

Die Variationen für Orchester von Arnold Schönberg sind schwer zu spielen, aber nicht schwer zu hören! Vom Ausdruck her handelt es sich um eine normale Variationsreihe. Die Kluft von Schönbergs bekanntem Streichsextett Verklärte Nacht, das er 1899 komponierte und 1917 auf eine Fassung für Streichorchester erweiterte, die er 1943 revidierte, ist nicht so groß, wie man sie erwarten würde. Diese Musik beruht auf Tradition, in diesem Fall besonders auf dem Geist der Spätromantik mit ein paar „falschen“ Tönen! Die Variationstechnik und die Zwölftontechnik sind nichts anderes als eine Selbstdisziplinierung des Komponisten. Jede der neun Variationen hat einen eigenen Grundcharakter. Die Einleitung bezieht sich auf den Impressionismus mit seiner Farbigkeit, das anschließende Thema auf eine Valse triste. In der zweiten Variation klingt ein Siciliano im 9/8-Takt an, der lieblich anmutet. In der vierten Variation wird ein Walzer hörbar. Die sechste Variation hat etwas Leichtes, Spielerisches. In der siebten Variation gibt es eine Nachtmusik, die Anklänge bei Gustav Mahlers Siebter Symphonie nimmt, die achte Variation – „sehr rasch“ – greift Maschinenmusik auf, die neunte Variation ist wie der Tanz einer Ballerina. Das Presto-Finale ist eine Schnellpolka, ein Kehraus. Beim Hören der Variationen für Orchester geht es um die Aussage der Musik und um ihren emotionalen Ausdruck, nicht um das intellektuelle Wissen über Formen und Techniken. Zur Frage über das Erkennen einer Zwölftonreihe meinte Schönberg am 27. Juli 1932 in einem Brief an seinen Schwager, den Geiger Rudolf Kolisch: „Glaubst Du denn, dass man einen Nutzen davon hat, wenn man das weiß? Ich kann es mir nicht recht vorstellen.“

In einem Interview beklagte sich Maurice Ravel über Pariser Orchester, die La Valse gespielt haben: „Sie spielen La Valse wie einen Wiener Walzer“ – das finde ich sehr lustig! Der Wiener Walzer bedeutet viel Rubato, hier aber sollte er sehr klassisch gespielt werden. Die Regieanweisung am Beginn der Partitur ist das Motto: „Flüchtig lassen sich durch schwebende Nebelschleier hindurch tanzende Walzerpaare erkennen. Nach und nach lösen sich die Schleier auf: Man erblickt einen riesigen Saal mit zahllosen im Kreise wirbelnden Menschen. Die Bühne erhellt sich zunehmend. Die Kronleuchter erstrahlen in hellem Glanz beim Fortissimo. Eine kaiserliche Residenz, um 1855.“ Der Dirigent Willem Mengelberg hat als Erster auf die Apotheose des Walzers, das Rauschhafte, das Sich-Auflösen hingewiesen. Später meinte Ravel, der seine Komposition aus dem historischen Kontext des Ersten Weltkriegs abheben wollte: „Es ist eine tanzende, kreisende, ja fast halluzinierende Extase, ein Wirbel von Tänzerinnen, die sich mit letzter Leidenschaft bis zur Erschöpfung ausschließlich durch den Walzer mitreißen lassen“. Die letzten zwei Takte mit Quartole sind die einzigen, die nicht im Walzer-Rhythmus sind. „Es ist aus“, kommentierte Ravel, als er über den Schluss gefragt wurde. Durch den Walzer entsteht ein Sog, der einen nicht verführen soll, sich im einzelnen Moment zu verfangen oder sich diesem hinzugeben – ganz wie bei Richard Strauss! Ravel war neugierig auf Werke seiner Zeitgenossen wie Puccini, Mahler, Schönberg. Er kannte die Stravinsky-Ballette der Ballets russes, er wusste um die Anforderungen Sergej Diaghilevs – und dann schreibt er so etwas? Somit hat er uns ein ungelöstes Rätsel hinterlassen.